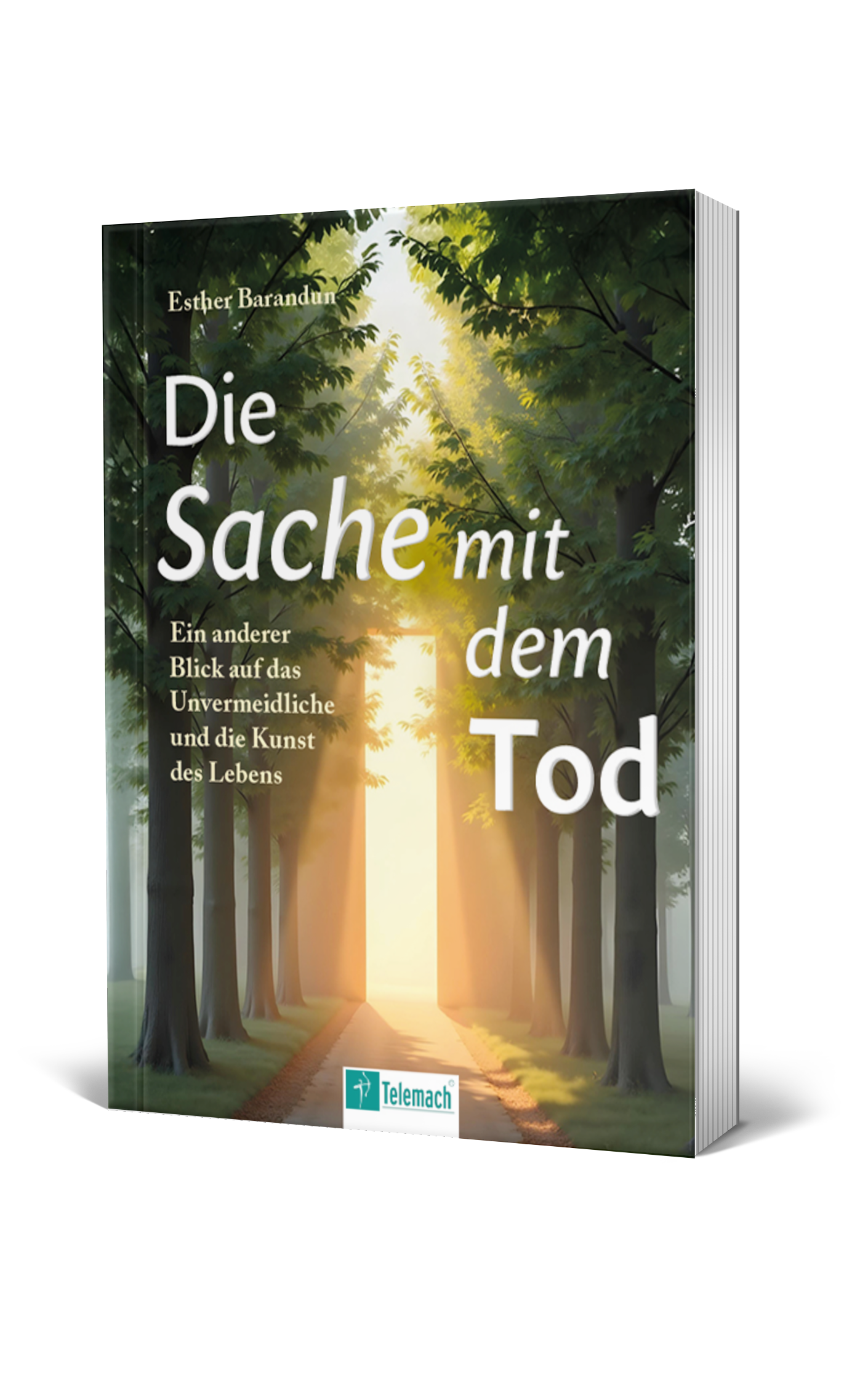
Leseprobe
die Macht der fokussierten Angst
Die Angst vor etwas wächst mit der Definition der Bedrohung. Je eindeutiger und klarer diese ausfällt, desto grösser ist die Angst. Wer eine um sich greifende Furcht auslösen will, muss die Bedrohung präzisieren und sehr genau fokussieren. Dann ziehen sich das Bedrohliche und die Angst magisch an, verbinden sich und wachsen zur Panik. Damit lässt sich führungstechnisch gut arbeiten, wenn es darum geht Macht aufzubauen oder zu erhalten.
Die Vergangenheit ist voller Beispiele von Gesellschaften, Religionen, Diktatoren und Despoten, welche die Angst als Führungsmittel eingesetzt haben. Auch kleine Gruppen, vielleicht in einem spirituellen Wahn, nutzen die Macht der Angst. Doppelmoral und Unsicherheit sind fürs Individuum einschneidende Folgen. Wer unter solchen Umständen den Regeln entspricht und keine Fehler macht, hat meist einfach nur Glück. Der Grat zwischen richtig und falsch ist so schmal, dass nur die Führung und ein paar Getreue, diesen schadlos überqueren können. Die grosse Allgemeinheit ist auf Goodwill oder Gnade angewiesen.
Hatten Sie schon den Mut, eigenständig über Abtreibung und Sterbehilfe nachzudenken und Ihre Erkenntnisse öffentlich auszusprechen? Es geht nicht um eine Kampagne, nur um einen Austausch zum Teilthema Sterben und Tod ausserhalb des stillen Kämmerleins. Was macht dieses Nachdenken oder Aussprechen so schwer? Sind es nur die tradierten und gelernten Bilder, Verbote und Gebote? Steckt vielleicht die Angst vor dem Tod dahinter, die Angst vor der Rache einer höheren Macht oder bösen Geistern oder die geheime Furcht vor dem Teufel?
Legen Sie Ihre Hand aufs Herz und fragen Sie sich, was stärker wirkt: die Vorstellung oder die geschehende Realität? Ohne alle knapp acht Milliarden Menschen gefragt zu haben, erkläre ich, Folgendes zum Faktum: niemand hat den Teufel des Jenseits mit den Augen des Diesseits je gesehen. Trotzdem gibt es unzählige Bilder von dieser sagenumwobenen Gestalt. Einerseits ist er der mächtige Herr der Finsternis, andererseits kann ihn sogar ein Menschlein übers Ohr hauen, wie in Sagen berichtet wird. Hierzu empfehle ich die Sage zur Teufelsbrücke auf dem Weg zum Gotthard oder das Grimm Märchen vom schlauen Bäuerlein, das dem Teufel den Goldschatz abgeluchst hat.
Die Religionen drohen mit dem Teufel, der ewigen Verdammnis und Strafen der Finsternis, während das Volk mit List und Schläue (beides Anteile der berechnenden Fantasie) Auswege aus dieser Not findet. Menschen machen Fehler. Also dürfen und sollen die Menschen auch Wachsamkeit, Mut und Fantasie trainieren. Das kann eine Strategie des Überlebens sein.
Das Nachdenken über das Tabu Suizid und auch über die Sterbehilfe fordert uns alle heraus. Bis vor wenigen Jahrzehnten richteten sich die staatlichen Gesetzte nach den gewohnten kirchlichen Erklärungen. Daraus ist wohl auch die Strafbarkeit durch weltliche Gerichte entstanden. Diese wurde in einigen Staaten abgeschafft, in anderen gilt sie immer noch. In allen Nationen werden die Einstellungen zu Suizid und Sterbehilfe immer wieder hinterfragt. Das ist gut und wichtig. Forschungen verschiedener Fachrichtungen suchen Lösungen, wie mit solchen Situationen ethisch und menschlich umgegangen werden könnte. Neue Erklärungen und Sichtweisen bekommen immer mehr Raum.
In einer Gesellschaft sind grundlegende Veränderungen oft Langzeit-Baustellen. Bis zur allgemein gültigen Verankerung von tiefgreifenden Veränderungen müssen einzelne Mitglieder - wenn sie sofort eine Lösung brauchen - selbständig intensiv nachdenken, sorgfältig nach Antworten suchen und nach eigenem Gewissen entscheiden. Oft werden sie dabei zu PionierInnen und brauchen ein starkes Rückgrat, um sich gegen Vorurteile oder gar Urteile der Gesellschaft durchzusetzen.
Ein Suizid ist eine bewusste, oft geplante Handlung, die das Ende des Lebens zum Ziel hat. Redewendungen wie 'hat sich zu Tode getrunken, geraucht, gestresst, ... und damit Suizid auf Raten begangen' sind sarkastische Äusserungen, die nur verletzen. Eine Sucht ist kein Suizid auf Raten, sondern ist eine besondere Suche. Kein Mensch gibt sich einer Sucht hin mit dem Ziel zu sterben. Ein Mensch, der zu viel trinkt, tut dies genauso wenig wie ein Mensch, der durchs Leben stresst. Alle Menschen in einer Sucht sind auf der Suche nach etwas in ihrem Leben. Auch wenn sie wissen, dass diese Art der Suche nicht wirklich funktioniert, können sie nicht anders. Zu diesem 'warum' sucht die Forschung immer noch nach Antworten.
Das Recht auf Leben ist ein Menschenrecht und eigentlich genauso das Recht auf Tod. Diese beiden Rechte sollten gleichgestellt werden. Die Verbote von Suizid und Sterbehilfe sind eine Entmündigung eines mündigen Menschen und mit einer Demokratie nicht vereinbar. Wer fähig ist, Steuern zu zahlen, abzustimmen, zu wählen und zu arbeiten, ist sehr wohl in der Lage, über das eigene Leben und den eigenen Tod nachzudenken und entsprechend zu handeln. Die Versuche, diese Menschen mit Gerichtsverhandlungen zu demotivieren oder bei einem missglückten Suizid mit einem verordneten Klinikaufenthalt zu stigmatisieren sind keine würdevollen Mittel. Darüber müssen Völker und Gesellschaften noch viel nachdenken.
Letztes Jahr besuchte ich einen über neunzigjährigen Mann, rüstig und geistig fit. Er ahnte eine heranschleichende Demenz und war vom Leben erfüllt. Daher plante er, mit Sterbehilfe sein Leben zu vollenden, was in der Schweiz - mit Hürden verbunden - aber möglich ist. Ruhig und zufrieden sass er auf seinem Stuhl und wartete darauf, dass endlich die Türe aufging und seine Erlösung vom Leben nahte. Seine Müdigkeit vom Leben war spürbar. Der Körper hätte wohl noch einige Jahre durchgehalten. Doch er hatte genug erlebt und wollte gehen. Wir verabschiedeten uns und eine Stunde später durfte er - wie sehnlichst gewünscht - im Kreise von Ehefrau und Tochter friedlich einschlafen. Er hatte seinen Frieden gefunden. Während seine Tochter den Wunsch des Vaters annehmen und in ihr Leben einbauen konnte, brauchte seine zurückgelassene Frau einige Zeit, um dieses Erlebnis zu verarbeiten. Trotzdem war sie immer überzeugt, dass ihr Mann für sich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Sie waren siebzig Jahre verheiratet gewesen und hatten vor zwanzig Jahren den Tod der älteren Tochter durchgestanden. Auf ihrem Eheweg gingen die Beiden stets wertschätzend miteinander um und konnten auch jene Entscheidungen annehmen, die weh taten. Sie haben bewusst den Tod eingeladen und als er kam, ihm die Türe aufgemacht und einander losgelassen. Diese zwei Menschen verdienen Respekt und Achtung.
Grosse Veränderungen sind für eine Gesellschaft grosse Herausforderungen. Normen können Halt geben und gewohnte Einstellungen können Sicherheit vermitteln. Wenn diese wegbrechen, fällt die Welt aus den Fugen. Die Geschichte hat gezeigt, dass sie immer wieder einpendelt. Die Zeit des Einpendelns verlangt von der jeweiligen Gesellschaft und deren Mitglieder Durchhaltevermögen und Optimismus. Wenn es Gründe gibt, den Tod aus einer Gesellschaft zu verbannen, wenn spirituelle Erklärungen nicht mehr greifen oder eine Gesellschaft zu beschäftigt ist, bricht die Zeit für individuelles Nachdenken an. Was dem Leben dient, wächst normalerweise von unten nach oben, vom Kleinen zum Grossen; in diesem Fall vom Individuum zur Gesellschaft.
Die Diskussion um Suizid und Sterbehilfe sind wahrscheinlich die wichtigsten und notwendenden Anstösse zur Auseinandersetzung mit der fokussierten Angst. Wenn die Vorstellung vom Tod als Bedrohung bröckelt, bekommen neue Bilder Raum. Der Fokus wird neu eingestellt. Wieso ist der Tod männlich? Diese Idee hat nichts mit Gleichstellung, sondern mit Vorstellung zu tun. Die Tod ruft ganz andere Bilder hervor. Starten Sie in einer vertrauten Gruppe ein Gespräch über 'der Tod oder die Tod'. Ich bin überzeugt, das Ergebnis wird wohltuend, vielleicht sogar befreiend überraschen.
Unser selbstverständlicher Umgang mit Vorstellungen findet in der darstellenden und dichterischen Kunst vielfältigen Ausdruck. Der Western 'Spiel mir das Lied vom Tod' fesselt bis heute. Geisterbahnen und spukende Hotels ziehen magisch an. Untote und Gespenster haben ihren mitternächtlichen Ausgang zwischen 24 Uhr und ein Uhr morgens früh. Sagen halten Touristen und Neugierige in Schach. Wieviel Wahrheit dahinter steckt, wollen wir gar nicht wissen. Diese Geheimnisse dürfen bleiben. Sie sind prickelnd und gruselig, ziehen magisch an und bieten ein natürliches Angsttraining in einer Gruppe grosser und kleiner 'Schisshasen'.
Was genau verursacht diese Angst vor dem Tod? Geht es um die Angst vor dem Tod oder um die Angst vor dem Sterben?
Beide Ängste wurden vielleicht bei der Geburt zum ersten Mal erlebt, Das auf die Welt kommen war damals auch kein Zuckerschlecken. Es war ein harter Kampf, durch das engste Tor der Welt zu schlüpfen und dann einen Kälteschock in blendender Helligkeit und bei viel Lärm zu ertragen. Kaum war der erste Atemzug vollbracht, kam auch schon die erste Spritze.
Die Ankunft bei den Menschen ist wahrlich brutal. Befürchten wir bei Sterben und Tod ebenfalls ein Schockerlebnis? Vor der Geburt wussten wir auch nicht, was uns blühte.
Menschen, die von positiven Nahtoderlebnissen erzählen, fügen oft an: "Ich habe jedenfalls keine Angst mehr vor dem Tod." Diese Überzeugung strahlen sie von Kopf bis Fuss aus. Mein erster Gedanke ist jedes Mal: "Die haben es gut." Doch gratis kamen diese Menschen nicht zu ihrer Einsicht. Auf diesen Weg zum Tor an der Grenze kommt nur, wer sterbenskrank oder in einen lebensbedrohlichen Unfall verwickelt ist. Es sind intensive Erfahrungen. Solche Erzählungen können Mut machen und Vertrauen vermitteln. Sie lassen ein Bild voller Zuversicht und Geborgenheit entstehen.
Mut zur Wirklichkeit
Solange wir unter den Lebenden wandeln, befinden wir uns auf dem Boden der irdischen Realität oder des Diesseits. Unser Wissen und unsere Vorstellungen sind hier entstanden und entwickelt worden. Die Ansprüche an das Wissen haben sich durch die Jahrtausende immer wieder verändert. Tradiertes Wissen wird gerne mit Herzblut verteidigt. Einerseits kommen liebgewordene Gewohnheiten auch im Denken vor, andererseits können neue Errungenschaften hergebrachtes Gedankengut nicht immer adäquat ersetzen. Altes und Neues muss sich manchmal schleifen, bis sie sich nahtlos ablösen können.
Bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts waren Kirche und Staat eng miteinander verbandelt. Der Einfluss der christlichen Kirchen war überall spürbar. LehrerInnen wurden nur angestellt, wenn ihre Konfession jener der Gemeinde entsprach. So erhielten die Kinder auf breiter Ebene die richtige, angemessene oder erwartete Erziehung mit der richtigen Vorstellung von Tod und Jenseits.
Bis in die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts war diese Anzahl von Menschen ohne Religionszugehörigkeit verschwindend klein. Seit den neunziger Jahren nimmt diese Anzahl immer schneller zu. In der Schweiz sind wenig mehr als 30% Mitglieder einer Kirche, etwas grösser ist die Gruppe jener, die keiner Religion angehören. Diese Entwicklung schreitet immer schneller fort.
Früher lag das ultimative Wissen über das Jenseits in der Hand der Kirchen. Dieser Zustand hatte ihnen über Jahrtausende Macht und Einfluss gesichert. Wer direkt mit Gott verhandeln kann, ist über alles erhaben und hat nichts zu befürchten. Mit dem Internet brach auch hier ein neues Zeitalter an: zum ersten Mal konnten sich alle Menschen, die wollten und Zugang zum Internet hatten, über religiöse Themen und Wahrheiten wissenschaftlich, spirituell, geschichtlich, mit Weitblick oder in engem Rahmen Informationen finden. Das Internet veränderte und forderte heraus. Denn wer sich selbständig neues Gedankengut aneignet, muss sich auch selbst damit auseinandersetzen. Das möchten nicht allen Menschen. Es gibt auch welche, die sind dankbar sind für den Rahmen, den ihnen die Kirchen bieten.
Mehr als tausendfünfhundert Jahre hatten kirchliche Obrigkeiten grossen Einfluss auf Politik und auf den einzelnen Menschen. Davon ist heute wenig, bis gar nichts mehr zu spüren. Nicht alle Menschen sind froh über diese spirituelle und religiöse Freiheit. Einer Religion anzugehören kann auch Halt geben. Die Vorstellung von Paradies und himmlischer Gemeinschaft hatte Vertrauen und Geborgenheit geschaffen. Kein Bild über das Jenseits zu haben, kann verunsichern oder gar belasten. Ein eigenes Bild von der Anderswelt zu kreieren ist eine Herausforderung, die sich lohnt. Daraus können Geborgenheit und Vertrauen wachsen.
Das Diesseits ist uns lieb und bekannt. Wir haben uns eingelebt und arrangiert. Wir wissen, was Sache ist, wo wir dazugehören, welche Gepflogenheiten vorherrschen, wie wir Schlupflöcher nutzen können und was uns erwartet, wenn wir Grenzen überschreiten. Unsere Lebenskonzepte sind auf dem Boden unseres Diesseits gewachsen, genauer gesagt, in jenen Gebieten, in denen wir leben, unser Umfeld kennen und regelmässig verweilen. Das Umfeld, wo wir uns zuhause fühlen, unser Wissen und Können erweitern oder uns engagieren, prägt Einstellungen, Sichtweisen und Weltanschauung. Heute können wir uns in vielen Ländern sehr frei bewegen, uns im Internet orientieren oder unzählige Aus- und Weiterbildungen absolvieren. Wer einen anderen Weg als den kirchlichen wählt, landet nicht mehr auf dem Scheiterhaufen. Dafür sind eigene Ansichten und Entscheidungen gefordert.
Es geschieht öfter, dass erwachsene Kinder erst beim Tod der Eltern erfahren, dass diese längst aus der Kirche ausgetreten sind. Unerwartet fallen sie aus gewohnten Denkweisen und aus einem vorgegebenen Rahmen. Sie sind gefordert, für die Trauerfeier einen eigenen Weg zu finden. Zum Glück stehen gute Angebote bereit. Genaueres dazu finden Sie im Kapitel 6.
Viele Menschen freuen sich über mehr Freiheiten und lassen sich gerne auf unbekannte Gebiete ein. Sie nehmen die Herausforderung von individuellen Entscheidungen an. Es gibt auch Menschen, die sich lieber nach Vorgaben richten, denn dort können sie Halt finden. Bei den Vorstellungen über Tod und Jenseits ist es ganz ähnlich. Immer mehr ist jeder und jede aufgefordert, über das Jenseits nachzudenken, das heisst, sich ein eigenes Bild zu machen oder persönliche Anhaltspunkte zu finden. Wer sich darauf schon eingelassen hat, weiss, dass Menschen irgendwann ein Bild oder eine Art Bild entwickeln. Wir Menschen sind auf Vorstellungen angewiesen. Diese müssen nicht unbedingt detailliert und genau definiert sein. Für die einen genügen Ahnungen, Schleier- oder Schattenbilder, symbolhafte Andeutungen. Andere brauchen genauere Konturen und Darstellungen.
Es gibt kein Jenseits ohne ein Diesseits und kein Diesseits ohne ein Jenseits. Das Vertrauen ins Diesseits beeinflusst das Vertrauen ins Jenseits. Die eigenen Vorstellungen vom Leben prägen auch die Vorstellungen vom Tod. Die Erwartungen ans Leben ähneln den Erwartungen vom Tod. Folglich ist es wichtig, sich der eigenen Vorstellungen vom Leben und vom Diesseits bewusst zu werden.
Das eigene Leben an die Hand zu nehmen, bedeutet, über die eigenen Erwartungen, Wünsche, Träume und Möglichkeiten im Bild zu sein. Unklare Vorstellungen führen genauso zu Irrungen und Verwirrungen, wie 'das Leben schlittern lassen'. 'Es lebt sich' kann während einer Auszeit eine interessante Erfahrung sein. Auf Dauer sind wir gefordert, uns im Klaren darüber zu sein, was uns wichtig ist, was wir erleben möchten.
Das Leben hält für uns unzählige schöne und wunderbare Überraschungen bereit, aber auch traurige, schreckliche und belastende Erlebnisse. Es erwarten uns persönliche Lernprozesse und Aufgaben, die wir ins Leben einbauen müssen. Ja, auch müssen. Denn oft werden wir gar nicht gefragt. Diese geschehen und wir haben uns zu arrangieren. Wir lernen unser Leben lang, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Dabei geht es nicht um grosse, beeindruckende Leistungen, sondern um ein ganzheitliches Lernen, um ein 'Schritt für Schritt der Vollendung entgegen' gehen.
Vertrauen ins Leben gewinnen wir, wenn wir Erfolge einfahren, das Meistern von schwierigen Aufgaben erleben, unsere Kraft und unsere Fähigkeiten testen, Geborgenheit und Akzeptanz erfahren. Vertrauen hat mit Sicherheit zu tun. Was wir kennen, macht uns sicher. Unbekanntes, Verborgenes kann Angst auslösen. Je stärker unsere innere Sicherheit ist, desto mutiger können wir dann, wenn die Stunde kommt, dem Tod die Türe aufmachen.
Wir alle wünschen uns eine sichere Leiter ins Universum oder einen bunten Regenbogen, über den wir leicht auf die andere Seite gleiten können. Wir haben Wünsche ans Leben und wir haben Wünsche an den Tod. Alle sind gleichberechtigt und haben ihre Daseinsberechtigung, denn sie sind für uns lebenswichtig.
Vertrauen wächst aus Erfahrungen mit Sicherheit und Geborgenheit. Freiheiten gewähren einen weiten Raum für eigene Vorstellungen und Möglichkeiten. Es lohnt sich darüber nachzudenken, was für Sicherheiten uns das Diesseits bietet. Diese bilden einen standfesten Boden für Vorstellungen und Bilder zum Jenseits.
Obwohl schon Pythagoras und Platon überzeugt waren, dass die Erde eine Kugelgestalt hatte, wurde diese Überzeugung immer wieder und in einigen Gruppierungen bis ins 21. Jahrhundert angezweifelt. Eine Scheibenform schien schlüssiger. In der Serie 'Asterix und Obelix' wird der Schamane von den Römern vermeintlich über die Kante der Welt hinuntergeworfen und landet überraschend in Amerika. Dieser Film nimmt die 'uralten' Erklärung wieder auf und lässt die Zuschauenden schmunzeln. Als Galileo Galilei erklärte, die Erde drehe sich um sich selbst, war das schon ungeheuerlich und, dass sie um die Sonne kreisen soll, war damals blasphemisch. In unserer Zeit gehören nicht nur diese Vorstellungen längst zum Allgemeinwissen, sondern auch die Reisen der Wikinger (790-1070) über den Ozean.
In Fernsehsendungen bieten Forscher verschiedener Fachrichtungen ungewohnte Sichtweisen auf Phänomene, die über den ganzen Erdball verstreut vorkommen. Ihre interessanten Schlussfolgerungen verändern auch die Sichtweisen aufs Universum, welches früher als Himmel bezeichnet wurde. Auf der ganzen Welt gibt es unerklärliche Phänomene, die bis vor Kurzem Fragen aufwarfen und keine Antworten erhielten. Diese werden immer wieder und aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht. Neue Erkenntnisse stören religiöse Vorstellungen. Deren Obrigkeiten kommen in Erklärungsnot und unterdrücken diese so lange wie möglich. Galilei musste seine Theorie, dass die Erde sich um sich selbst drehe, vor Gericht widerrufen. Erst auf seinem Totenbett sagte er klippt und klar: eppure si muove, und dennoch dreht sie sich. Vielleicht gehört das einfach zur Menschheitsgeschichte. Neues Gedankengut muss sich erst durchsetzen. Als die Flieger in den Himmel stiegen, fanden sie dort keine göttlichen Wohnsitze, dafür ein unendliches Universum. Die besondere Anziehungskraft der Sterne ist geblieben. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupery hatte keine Gefühle, nahm aber die Trauer über den Abschied wahr. So tröstete er den Piloten mit: "wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es für dich sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache." Wenn ich diesen Abschnitt in einer Trauerfeier vorlese, scheinen die Trauergäste Atem zu holen. Diese Worte trösten auch sie, denn sie zeigen eine Möglichkeit der Nähe auf. Ich bin sicher, manch eine/r guckt danach in den Sternenhimmel hinauf und findet dort Ruhe, Trost und Zufriedenheit.
Unser Leben findet in der Realität, also auf dem Boden der Tatsachen statt. Schon in der Kindheit lernen wir, was es heisst, etwas oder jemanden loszulassen, zu verlieren, nicht mehr zu haben. Nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene können im Spiel oder bei einem Wettkampf nicht verlieren. Für sie bricht dann eine Welt zusammen. Sie sind zutiefst getroffen und todunglücklich. Es scheint, als würden sie vom Leben und von der Welt beleidigt und bedroht. Das Leben hat ihnen noch nicht gezeigt, dass es möglich und leichter ist, einen Misserfolg mit einem Lächeln zu überleben.
Ein Leben lang lernen hat zur Folge, dass wir immer besser, leichter, selbstbewusster und zuversichtlicher mit vielen Herausforderungen umgehen können. Es sind auch solche dabei, die wir nicht meistern können. Auch diese gehören zum Leben. Das ist realistisch und gut so. Wir dürfen stolz sein auf alles, was wir geschafft und gemeistert haben. Misserfolge sind lebenswichtige Umwege. Erfolge stapeln ist erlaubt und erwünscht. Misserfolge sind ebenfalls Erfolge und gehören zum Stapel.
Das Leben möchte - dann, wenn die Stunde kommt - erfüllt und zufrieden vollendet werden.
21Fr, inkl. Versand, Bestellung

Leseproben
Die Gedichte dieser Seite dürfen mit Quellenangabe kopiert und verwendet werden.
Veröffentlichung einer Gedichtsammlung: 2027.
Der Klang des Lebens
Dein erster Schrei
ein Wohlklang für die Welt
mit eindrucksvollem Auftritt
beginnt dein eigenes Konzert
Dein erster Schritt
eröffnet zum Tanz des Lebens
mit Eigenstand und Eigensinn
kreierst du deinen Lebens-Rapp
In deiner Arena des Lebens
bestimmst du deine Nummern
dirigierst du nach deinem Rhythmus
führst du selbst dich
zu Sieg und Niederlage
Mit lauten und mit leisen Tönen
komponierst du dein Lied des Lebens
schallt deine Melodie durch die Welt
bis auch für dich der Vorhang fällt
Esther Barandun
Stein des Andenkens
am Ende der Grabstein
mit Blumen und Kerzenschein
ein Halt für die Trauer
und der Seele Klagemauer.
die Bilder der Vergangenheit
zerbröckeln in der Zeit
Erinnerungen verblassen
um Raum für Neues zu schaffen.
dein Grabstein zur Erinnerung steht
der Wind zu dir die Wünsche weht
und Dank, dass du mit uns gelebt
dein Lebensfaden ist verwebt.
Esther Barandun
